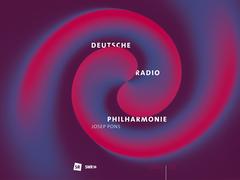Frankfurter Allgemeine Zeitung | Montag, der 3. November 2025
Von Jan Brachmann
Der Katalane Josep Pons übernimmt die Deutsche Radio Philharmonie in Saarbrücken. Er will zeigen, was die Konzertform geistig leisten kann – auch durch reine Bezauberung mit der Sopranistin Julia Lezhneva.
So geht das nicht weiter! Josep Pons schüttelt den Kopf und schaut ins Leere: „Immer nur schwarz oder weiß, ja oder nein, goldrichtig oder grundfalsch. Attacke auf Attacke, schnelle Urteile überall. Wo kommen wir da hin? Die populistischen Politiker, die sozialen Netzwerke treiben uns allen Sinn für Ambivalenzen, für das Zweideutige, Zwielichtige, Unentscheidbare aus! Dabei brauchen wir diesen Sinn. Es ist doch gerade die Kunst, die uns diese Ambivalenz zumutet, die uns als Publikum damit konfrontiert, wie wenig eindeutig eine Entscheidung zu treffen ist und dass eine Entscheidung tragisch sein kann, die unter Zeitdruck getroffen werden muss.“
Pons, 1957 im katalanischen Puigreig geboren, ist mit diesem Herbst neuer Chefdirigent der Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern. Das Orchester hatte mit dem vorigen Chef gute Jahre und erfolgreiche Auslandstourneen: Pietari Inkinen, selbst ein exzellenter Geiger, hat für einen seidig-singenden Streicherklang von hoher Transparenz gesorgt bei gleichzeitig spannungsreicher Phrasierung in den langen Linien der Symphonik von Rachmaninow, Sibelius und Dvořák. Pons, seit 14 Jahren Musikdirektor des Teatro Liceu in Barcelona, kommt hingegen vom Chorgesang: Als Siebenjähriger wurde er Mitglied der Escolania de Montserrat, eines Knabenchores, der seit dem zwölften Jahrhundert die Gottesdienste im Kloster Santa Maria in Montserrat gestaltet. Den Schulleiter Ireneu Sagarra bezeichnet Pons als den wichtigsten Lehrer seines Lebens: Er habe ihn eingeführt in die Kultur des Gregorianischen Chorals, sodass er sich selbst völlig zu Hause fühle in einem geistigen Kontinuum von neun Jahrhunderten.
„Zugleich aber spielte die Moderne eine große Rolle im Kloster“, wendet Pons ein. „Nachdem das Zweite Vatikanische Konzil die lateinische Messe abgeschafft hatte, brauchten wir neue liturgische Musik auf Katalanisch. Das Kloster vergab damals Aufträge an Ernst Krenek und Petr Eben. So sang ich schon im Knabenchor Neue Musik.“ Dem Neuen gegenüber blieb er aufgeschlossen. Er schwärmt von der Arbeit mit Katharina Wagner, deren Inszenierung des „Lohengrin“ er im März dieses Jahres herausbrachte: „Sie hat Lohengrin als Mörder Gottfrieds dargestellt. Nur der Schwan war Zeuge, weshalb Lohengrin am Ende auch den Schwan tötet. Es ist gut, dass sich die Oper erneuert hat, so wie sich die Museen erneuert haben. Nur im Konzert haben wir immer noch die gleichen Kleiderordnungen, Programmfolgen, Applaus- und Pausenrituale wie vor achtzig oder hundert Jahren.“
Daran will er bei der Deutschen Radio Philharmonie, seiner ersten Chefstelle außerhalb Spaniens, etwas ändern – und zwar nicht durch die viel beschworenen „neuen Formate“ mit Musik zu Spaßgetränken bei buntem Licht oder kommentierte Sitzungen betreuten Hörens, sondern dadurch, dass die Programme selbst Inhalte, Bezüge, Fragestellungen vermitteln. Das erste Studiokonzert im Großen Sendesaal des Saarländischen Rundfunks auf dem Halberg in Saarbrücken gab dafür ein besonders sinnfälliges Beispiel: Es begann mit dem Marsch für die Zeremonie der Türken aus Jean-Baptiste Lullys Schauspielmusik zu Molières „Der Bürger als Edelmann“ aus dem Jahr 1670. Pons ließ sich dafür einen großen Dirigierstock fertigen und schlug damit auf dem Boden den Takt wie weiland Lully selbst (er starb sogar 1687 daran, weil er sich den Stock durch den Fuß gerammt und eine Blutvergiftung zugezogen hatte). Pons schloss mit der Suite „Der Bürger als Edelmann“ von Richard Strauss und ließ beim Auftritt des Cléonte zunächst Celli und Bratschen, dann auch die Geigen ohne Vibrato spielen. Ein großartiger Effekt: Es wurde schlagend klar, dass Strauss hier 1917 zurückgreift auf den Klang eines Gambenconsorts und damit auf den Hof Ludwigs XIV. Das ist ästhetische Erfahrung als sinnliche Erkenntnis: Aufklärung durch Genuss.
Zwischen Lully und Strauss standen Arien von Händel und Mozart. Und zu bewundern war, wie gekonnt die Streicher der Deutschen Radio Philharmonie die kleinteiligen Stricharten der historisch informierten Spielpraxis, dazu die bauchige Wölbung von Haltetönen ganz nach Vorschrift der Violinschule Leopold Mozarts auf die gleichen Instrumente übertrugen, mit denen sie sonst Dvořák, Prokofjew oder Mahler spielen. Und natürlich gehört auch ein Dirigent dazu, der mit solcher Souveränität über Kenntnisse in den unterschiedlichen Spielpraktiken dreier Jahrhunderte verfügt.
Über die Sängerin Julia Lezhneva ist vielleicht schon alles gesagt, wenn man festhält, dass sie stimmlich eines der größten Wunder der Welt seit Cecilia Bartoli ist. Allein schon das rhetorische Gespür, mit dem sie die Anfangsworte von Händels „Rejoice, rejoice, rejoice greatly!“ singt: Sie legt dieses Trikolon von Exklamationen als Klimax an, um sich auf dem Wort „greatly“ jauchzend zu überstürzen! Es ist ein präzises Verständnis rhetorischer Mittel, das sie auf charismatische Weise mit Leben füllt. In den Arien Mozarts macht sie spontane Verzierungen und Melismen – jedes Mal bei den Proben anders, berichtet Pons –, als gehöre das Ornament zur Muttersprache ihrer Stimme.
Schwergewicht der Orchesterlandschaft
Pons, der kulturgeschichtlich ungeheuer belesen ist, reaktiviert in seiner Programmgestaltung für die kommenden drei Jahre das höfische und geistliche Erbe Europas, um Räume für Ambiguitätstoleranz zu verteidigen, ganz als habe er Thomas Bauers Essay „Die Vereindeutigung der Welt. Über den Verlust an Mehrdeutigkeit und Vielfalt“ verinnerlicht. Durch solch eine intellektuelle Streitlust wird auch die Deutsche Radio Philharmonie erneut zu einem Schwergewicht in der Orchesterlandschaft.
JAN BRACHMANN
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main